Wenn Harmonie zur Falle wird – oder warum „Mach es allen recht!“ Teams schadet
Alle sind zufrieden, die Stimmung ist gut, es gibt keine Konflikte – perfekt, oder? Manchmal ist genau das das Problem.
Was ist der „Mach es allen recht“-Antreiber?
Sie verlassen ein Teammeeting und denken: „Läuft doch alles super.“ Keine lauten Stimmen, keine Diskussionen, alle nicken freundlich. Doch dann erreicht Sie Wochen später die Kündigung einer Leistungsträgerin. Und Sie verstehen die Welt nicht mehr. Haben Sie das schon mal erlbt?
Als Führungskräfte-Coach erlebe ich solche Momente häufiger, als viele denken. Und dahinter steckt oft ein Antreiber, der besonders heimtückisch ist: „Mach es allen recht!“
Warum dieser Antreiber so gefährlich ist
Während „Sei perfekt!“ oder „Beeil dich!“ relativ schnell sichtbar werden, wirkt „Mach es allen recht!“ zunächst wie eine Führungsstärke. Wer will nicht eine Chefin, die alle einbezieht, auf Harmonie achtet und ein wertschätzendes Klima schafft?
Das Problem: Wer es allen recht machen will, macht am Ende niemandem mehr etwas recht. Schon gar nicht sich selbst.
Eine Geschichte aus meiner Praxis
Vor kurzem begleitete ich Ute, Leiterin einer Finanzabteilung in einem mittelständischen Unternehmen. Kompetent, erfahren, beim Team beliebt. Ihre Meetings? Immer konstruktiv. Die Atmosphäre? Freundlich und respektvoll. Ute war stolz darauf, wie gut ihr Team harmonierte.
Dann kam der Schock: Martina, eine ihrer besten Mitarbeiterinnen, bat um ein Gespräch. Sie wolle die Abteilung wechseln. Sofort.
„Ich kann nicht mehr mit Stefan zusammenarbeiten,“ sagte Martina. „Er spielt sich als Dein Stellvertreter auf, obwohl er das gar nicht ist. Er maßregelt uns, trifft Entscheidungen über unsere Köpfe hinweg, und Du… Du sagst nichts.“
Die Führungskraft ist überrascht – das Team nicht
Ute war fassungslos. „Stefan ist doch engagiert. Er bringt sich ein. Und die anderen haben nie etwas gesagt!“
Genau das war das Problem.
In unseren Coaching-Gesprächen wurde deutlich: Ute hatte die Signale übersehen. Stefans dominantes Auftreten in Meetings. Die zurückhaltenden Blicke der anderen. Die ausweichenden Antworten, wenn sie fragte: „Läuft alles gut?“
Sie hatte nicht nachgehakt. Weil nachbohren bedeutet hätte: Konflikt riskieren. Und Konflikt bedeutet: jemandem vor den Kopf stoßen. Stefan vielleicht. Oder dem Team. Und das wollte Ute auf keinen Fall.
Also tat sie, was Menschen mit einem „Mach es allen recht!“-Antreiber meist tun: Sie hoffte, dass sich das Problem von selbst löst.
Harmonie ist nicht gleich Teamgesundheit
„Ich dachte immer, wenn alle nett zueinander sind, stimmt die Teamchemie,“ sagte Ute nachdenklich. „Aber unter der Oberfläche hat es schon lange gebrodelt. Ich habe nur nicht hingeschaut.“
Gemeinsam erarbeiteten wir, was wirklich passiert war:
- Stefan hatte ein Machtvakuum erkannt – und gefüllt.
- Das Team wartete darauf, dass Ute eingreift – aber sie schwieg.
- Martina und andere zogen sich innerlich zurück, weil sie nicht mehr glaubten, dass sich etwas ändert.
- Die vermeintliche Harmonie war längst nur noch Fassade.
Die 3 wichtigsten Frühwarnsignale erkennen
Der „Mach es allen recht!“-Antreiber zeigt sich oft subtil. Achten Sie auf diese drei Muster:
- Schwierige Gespräche werden aufgeschoben: „Nächste Woche spreche ich mit Stefan. Wenn sich die Lage beruhigt hat.“
- Feedback wird weichgespült: „Das hast Du gut gemacht, aber vielleicht könntest Du künftig…“ (ohne klare Ansage)
- Konflikte werden ignoriert: „Die Beiden werden das schon unter sich klären.“

Von Harmonie zu Klarheit – drei konkrete Schritte
Erlauber-Strategien
Nach dieser Erkenntnis entwickelten wir für Ute konkrete Erlauber als Gegenpol:
1. Klarheit ist Wertschätzung
Konstruktive Kritik ist kein Angriff, sondern Orientierung. Stefan bekam klares Feedback: „Dein Engagement schätze ich. Aber Entscheidungen treffe ich.“
2. Nachfragen statt Annehmen
Gezielte Fragen stellen: „Wie läuft die Zusammenarbeit wirklich? Was stört Dich?“ – und die Stille danach aushalten.
3. Transparenz schaffen
Im Team offen ansprechen: „Mir ist Harmonie wichtig – aber nicht auf Kosten von Ehrlichkeit. Wenn etwas nicht passt, will ich das hören.“
Was sich verändert hat
Drei Monate später erzählte mir Ute: „Stefan war zunächst irritiert. Aber er hat sich gefügt. Und das Team… das Team atmet auf. Martina ist geblieben. Und ich merke: Die Stimmung ist nicht schlechter geworden. Sie ist echter geworden.“
Das Feedback aus dem Team bestätigte das:
„Ute traut sich jetzt, klar zu sein. Und das ist gut. Wir wissen endlich, woran wir sind.“
Was wirksame Führung wirklich ausmacht
Harmonie um jeden Preis kostet am Ende das Wertvollste: Vertrauen, Klarheit und die besten Leute. Echte Führung entsteht nicht durch das Vermeiden von Konflikten, sondern durch den Mut, sie konstruktiv auszutragen.
Ute hat gelernt: Gute Stimmung im Team ist wichtig – aber nicht, wenn sie auf unausgesprochenen Frustrationen ruht. Heute sagt sie: „Ich habe keine Angst mehr vor unbequemen Gesprächen. Denn ich weiß: Danach ist das Vertrauen größer, nicht kleiner.“
Sie erkennen sich oder Ihr Team wieder? Lassen Sie uns im Business Coaching gemeinsam schauen, welche Antreiber Ihre Führung prägen – und wie Sie sie in echte Führungsstärke verwandeln. Denn gute Führung bedeutet nicht, es allen recht zu machen. Sondern das Richtige zu tun.

 Vitaly Gariev_unsplsh
Vitaly Gariev_unsplsh
 Foto von
Foto von 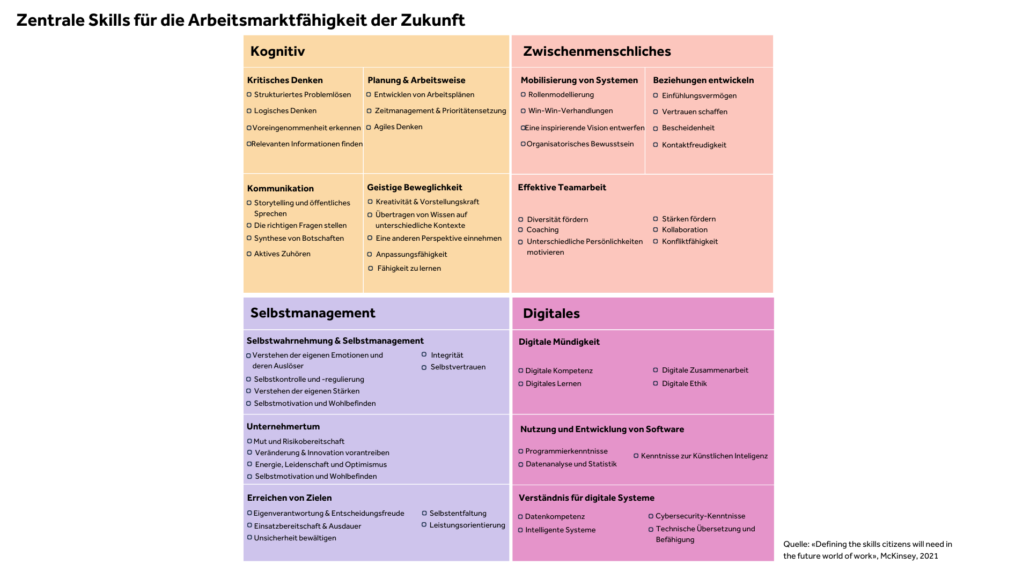
 yarenci-hdz-NsFqzwdI3Xo-unsplash
yarenci-hdz-NsFqzwdI3Xo-unsplash robert-mcgowan-d7Rrx5Ztm_o-unsplash.jpg
robert-mcgowan-d7Rrx5Ztm_o-unsplash.jpg https://digitalpeoplemanagement.de/wp-content/uploads/2025/12/maxime-ontI27q5k_8-unsplash.jpg
https://digitalpeoplemanagement.de/wp-content/uploads/2025/12/maxime-ontI27q5k_8-unsplash.jpg
 yosep-surahman-zcb1Peosu3M-unsplash-scaled.jpg
yosep-surahman-zcb1Peosu3M-unsplash-scaled.jpg

 gruescu-ovidiu-X_sSrreerk0-unsplash
gruescu-ovidiu-X_sSrreerk0-unsplash kemal-esensoy-Pq6BZmts8Y0-unsplash.jpg
kemal-esensoy-Pq6BZmts8Y0-unsplash.jpg